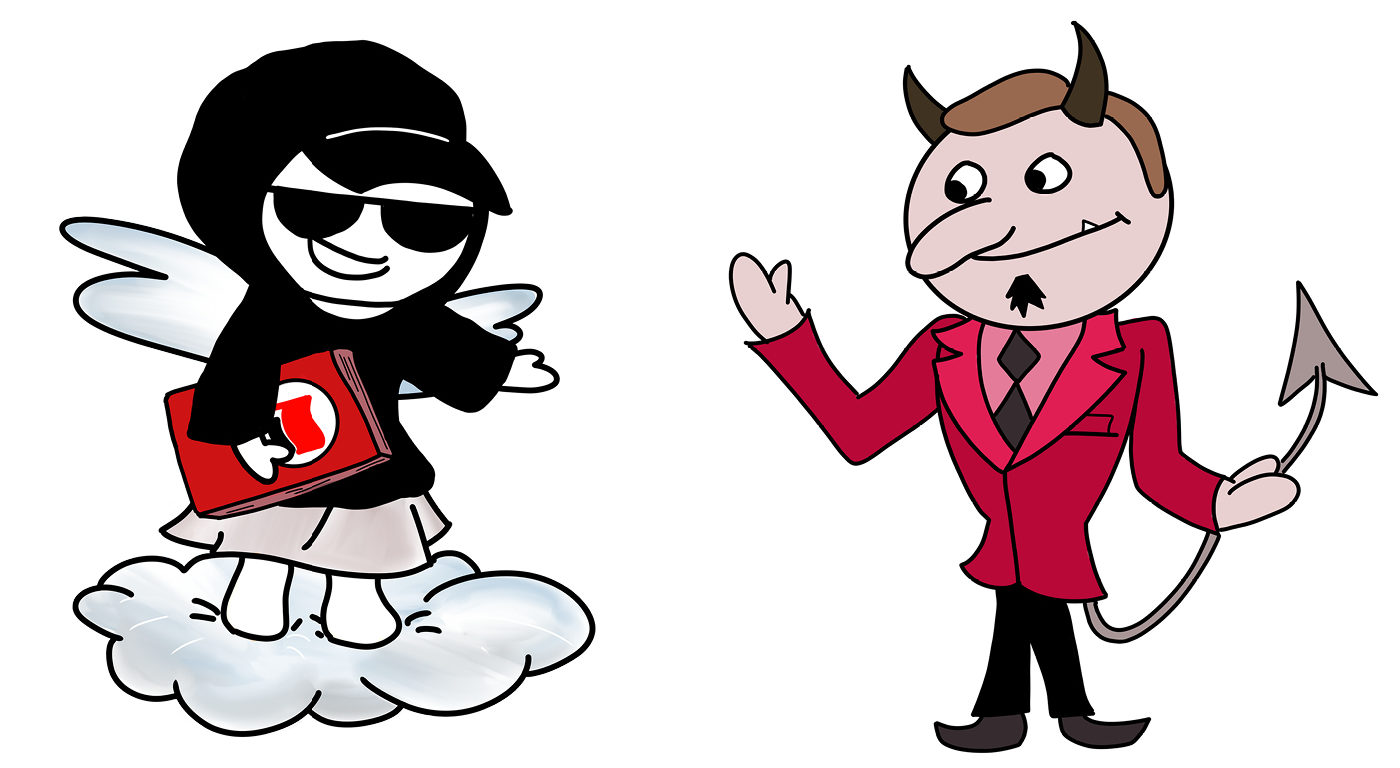Identity Politics – Wie Aggression und Arroganz eine gute Sache zunichtemachen
Klar, es geht im Kern um die Anerkennung von Minderheiten, die sich darüber Gehör verschaffen möchten und Toleranz und Respekt einfordern. Verstanden, gekauft. Der Tenor der Identity Politics- Debatten hört sich für viele aber so an: Weißer Mann – BÖÖÖÖSE, alle anderen – gut. Klar gab und gibt es unfaire strukturelle Machtunterschiede zwischen weißen Männern und allen anderen Gruppen von Menschen, die über die noch blaugrüne Erde wandern. Das hat soziohistorische und vor allem wirtschaftliche Gründe. Diese Strukturen ändern zu wollen, ist nicht nur ein legitimes Anliegen sondern auch bitter notwendig. Wie kommt es aber dazu, dass Aktivist*innen und Gruppen, die sich die Identity Politics auf die Fahnen geschrieben haben, oft mit Ihren Forderungen wie eingangs beschrieben wahrgenommen werden? Nun, daran sind sie nicht nur selbst schuld, auch der Identitätspolitik liegt ein inhärenter Trugschluss zu Grunde.
Zum ersten: Die Aktivist*innen der Identity Politics führen Ihren Kampf hart. Sehr hart. Sie betonen die Unterschiede der Ethnien und Kulturen, wollen dafür gefeiert werden diese Unterschiede so herauszuheben und gehen mit Kritiker*innen hart ins Gericht. Das fängt bei Boykottaufrufen an und hört bei der bewährten Nazikeule auf. Sie fordern Respekt für Diversität und Andersartigkeit. Die Hervorhebung der Einzigartigkeit bestimmter Gruppen führt aber zwangsläufig zu Exklusivität. Und genau das ist der Fehler der Identitätspolitik. Wir sind so und ihr seid anders – dieses Diktum vereint nicht, es trennt. Identitätspolitik versucht Differenz und Toleranz zu verknüpfen, sie scheitert aber daran, da dieses Narrativ zu Gruppendenken führt.
Zweitens: dem oben beschriebenen Narrativ der Einzigartigkeit fehlt das Verbindende – gerade hier lag immer die Stärke klassischer linker Überzeugungen. Die gute alte Arbeiter*innenklasse umfasste eben die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, ethnische oder kulturelle Unterschiede spielten keine Rolle. Solche starken Gemeinsamkeiten wie wirtschaftliche Herkunft verlieren sich aber durch die Betonung der Einzigartigkeit jeder noch so marginalen Gruppe. Das einzige was die Minderheiten in den identity politics eint ist ihre Unterdrückung durch den weißen Mann. Eine wichtige Gemeinsamkeit, die aber durch die Betonung auf das Einzigartige fast nivelliert wird.
Drittens: Der missionarische Charakter der Identity Politics erzeugt das Gefühl von Fremdbestimmung. Das ständige Pochen auf die Rücksichtnahme von Kulturen und Ethnien in Kunst und Medien wirkt wie die Ausübung von gesellschaftlichem Druck um bestimmte Inhalte darzustellen, die der eigenen Agenda entsprechen – häufig auch ohne die schaffenden Künstler*innen einzubeziehen oder das Werk genauer zu durchleuchten. Zudem wird eine Nichtberücksichtigung von Kulturen etc. in Medien und Kunst stets kritisiert und den Schaffenden zur Last gelegt – man legt den Künstler*innen hier stets alles zum Negativen aus. Davon bleibt dann das Gefühl von Zwang und versuchter Unterdrückung der Meinungsfreiheit zurück.
Die Mischung aus Aggressivität, Ausübung von Druck und der Tonfall in Zusammenarbeit mit der hohen Komplexität des Themas lassen die Opfer der Kritik der Identity Politics verwundert und verärgert zurück. Daraus kann nur ein von Anfang an vergifteter Diskurs entstehen. Ein hehres Ziel wird also durch Arroganz und Wut eher behindert als ermöglicht, die Gesellschaft in Gruppen gespalten und nicht in Toleranz und Empathie vereint.
Mit diabolischen Grüßen – der Anwalt des Teufels
Grundsätzlich sehe ich, dass der Diskurs um die Anwendung und Konzeption von Identitätspolitik sowieso bereits in eine klare Richtung geht. Mehr und mehr Leute erheben eine richtige und sinnvolle Kritik an den identitätspolitischen Debatten der letzten Jahre. Ich selbst habe das auch Jahre lang getan. Nur jetzt in dem Moment, wo die Kritik an Identitätspolitik immer lauter wird, setzt bei mir ein merkwürdiger Fahnenwechsel ein. Und das will ich hier ein bisschen erläutern:
Erstens: Ich finde es vermessen, sozialen Minderheiten die um ihre Anerkennung kämpfen und dabei in vielen Bereichen Fortschritte gemacht haben, vorzuwerfen Schuld an der Schwäche der Arbeiter*innenbewegung zu haben. Ganz besonders auch deswegen, weil die Kämpfe um die Anerkennung von Gleichstellung auf den Wohnungs- und Arbeitsmärkten eben auch ökonomische Klassenkämpfe sind.
Zweitens: Die großen Arbeiter*innenorganisationen in Westeuropa haben sich schon lange vor dem Aufkommen der modernen Minderheitsdebatten vom Revolutionsgedanken verabschiedet. Sie haben sich ab dem Moment verabschiedet, an dem sie sich mit der sogenannten sozialen Marktwirtschaft arrangiert haben. Erst danach, als deutlich wurde, dass vom Bulk der ehemaligen Arbeiter*innenbewegung keine Unterstützung mehr jenseits von Lippenbekenntnissen kommt, waren Minderheiten gezwungen sich ihre politische Vertretung jenseits der Reste der klassischen Arbeiter*innenbewegung zu suchen.
Drittens: Es gibt ein berühmtes Kitschbild vom „einfachen Arbeiter*“. Das ist ein fiktiver Mann*, der ein schmutziges Unterhemd trägt, den ganzen Tag am Fließband auf Blech einschlägt, abends nach Hause geht und in seinem Leben nur einfache Sorgen und einfache Gedanken hat. Dieser fiktive Mann*, mit seinen einfachen Gedanken, ist überfordert von der diffusen Menge von Minderheiten und ihren immer diffuser werdenden Forderungen.
Dieses Kitschbild ist antiemanzipatorischer Unsinn. Es wird zwar von Romanen, Medien und Komiker*innen ständig reproduziert, es aber politisch vertreten zu wollen, ist Identitätspolitik von der unterwürfigsten und dümmsten Sorte. Soziale Minderheiten sind und waren immer schon ein bedeutender Bestandteil der Arbeiter*innenklasse und ihrer Organisationen, auch wenn heute oft so getan wird als wären sie erst vor kurzem aufgetaucht. Dass diese Minderheiten darum kämpfen als Arbeiter*innen anerkannt zu werden, widerspricht nicht der Idee einer Vereinigung des Proletariats, sondern ist eine Voraussetzung dafür.
Viertens: In Deutschland hat es kaum eine Anwendung von emanzipatorischer Identitätspolitik gegeben. Es ist leider nicht zu leugnen, dass die meisten identitätspolitischen Schlagworte und Themen der letzten Jahre eben nicht von selbstorganisierten Minderheiten in Deutschland kommen. Sie wurden aus den USA kopiert, oft ohne darauf zu achten, ob das Thema in einem europäischen Kontext überhaupt Sinn ergibt. (Deutschland hat eine schreckliche Geschichte mit Rassismus, aber eine sehr andere als die USA) Und während es in den USA durchaus gute Gründe gibt, festzustellen, dass es mit der Identitätspolitik in manchen Ecken zu weit gegangen ist, stimmt das für Deutschland einfach nicht. Hätte es diese kritische Identitätspolitik in Deutschland gegeben wäre es gar keine Debatte ob man Politik für „einfache Arbeiter*“ oder „Minderheiten“ machen soll.
Fünftens: In den USA gibt es derzeit eine der schnellst wachsenden sozialistischen Bewegungen der Welt. Das passiert ausgerechnet in den USA, dem Wappenträgerland des Kapitalismus. Das dies genau jetzt passiert, zu einer Zeit wo sich Identitätspolitik scheinbar überholt hat, halte ich nicht für einen Zufall, sondern für einen zwingenden Zusammenhang. In den USA, mit ihrer jahrhundertelangen Geschichte von ultrarassistischen Gesetzen und Schlimmerem, war es dringend notwendig, diese Geschichte aufzuarbeiten. Dort waren es Identitätspolitische Bewegungen, die diese Aufarbeitung angestoßen haben. Diese Aufarbeitung war und leibt konfus. Aber sie war und ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ein solidarischer Klassenkampf möglich ist.
Abschließend: Identitätspolitik ist weder gut noch schlecht. Sie ist einfach was sie ist. Sie findet statt und hat auch immer schon stattgefunden und sie gewinnt im Kapitalismus an Relevanz. Dabei ist es immer wichtig, zu schauen, was Identitäten ausmacht und wie sie gestalten werden. Es macht einen Unterschied ob sich eine gesellschaftlich dominante Gruppe (z.b: weiße Männer) identitär abgrenzen will, oder ob eine benachteiligte Gruppe sich emanzipieren will. Aber auch hier macht es einen Unterschied, ob hinter dieser Identität eine demokratische Organisation steckt, eine identitäre Obrigkeit, oder gar ein Unternehmen, dass einfach nur seine Zielgruppe kennt. Identitätspolitik findet statt, ob wir es wollen oder nicht. Die Frage ist ob es uns gelingt sie kritisch zu begleiten und zu gestalten.
Aber um es noch einmal deutlich zu sagen: Soziale Minderheiten, ihre Benachteiligungen und Kämpfe um Anerkennung, gehören zu der Lebensrealität der Arbeiter*innenklasse dazu. Nur eben nicht zu der Lebensrealität des fiktiven „einfachen Arbeiters“, wie ihn bürgerliche Komiker*innen ständig darstellen. Aber nichts gehört zur Lebensrealität des „einfachen Arbeiters“, weil er in der Realität gar nicht existiert. Er ist ein Hirngespinst. Kein Mensch ist einfach. Alle Menschen sind komplex.
Antifaschistische Grüße – der sozialistische Engel